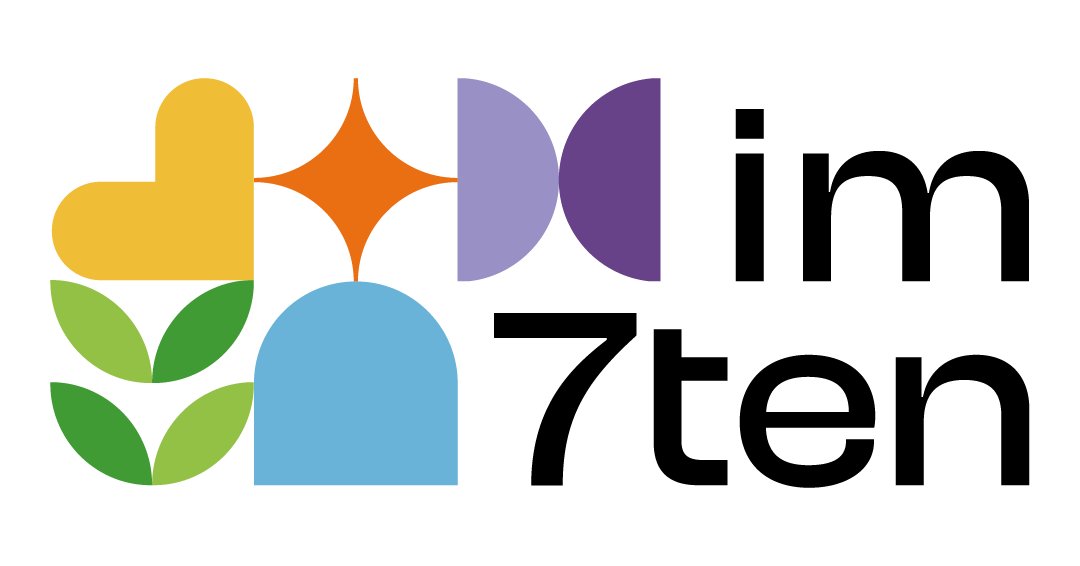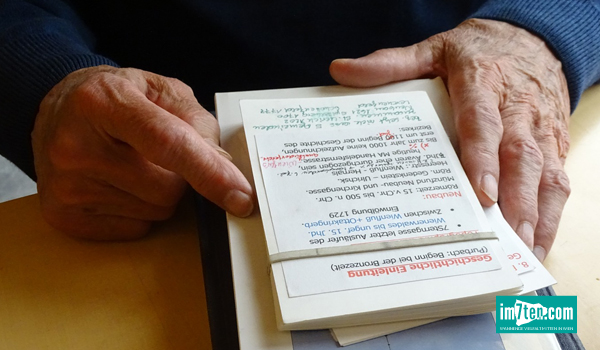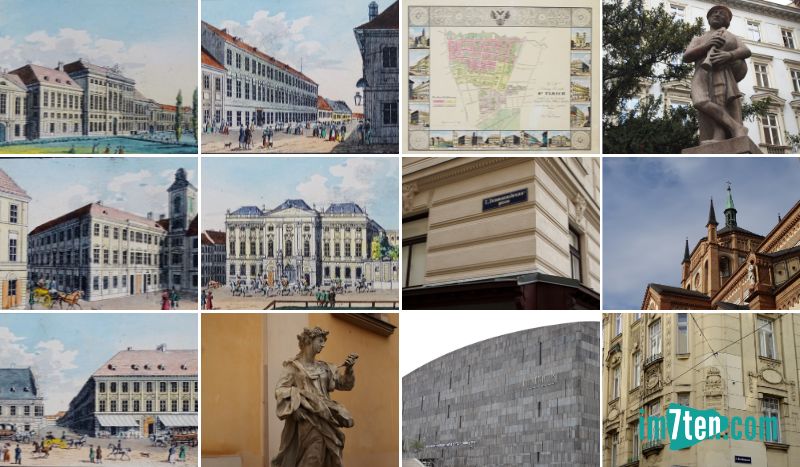Eine liebevolle Betrachtung von Herbert Tamchina
Im dritten und letzten Teil habe ich mit Herbert Tamchina über seine Zeit als Bezirksvorsteher im 7. Bezirk gesprochen. Ansichten und Einsichten über das Verbeißen, wenn es nötig ist, und das Loslassen, wenn der richtige Moment gekommen ist.
Mit sieben Jahren zieht Herbert Tamchina mit seiner Mutter in den 7. Bezirk. Schon als Jugendlicher engagiert er sich im Nachkriegs-Österreich politisch. Viele Jahre ist er in der Personaldirektion der ÖBB tägig, bevor er 1991 zum ersten SPÖ-Bezirksvorsteher des 7. Bezirks in der 2. Republik gewählt wird und sein Amt bei der BezirksvertreterInnenwahl 1996 verteidigt. Siebeneinhalb Jahre fegt er durch den Bezirk und sorgt für Wirbel und frischen Wind.

Nicht nur beim MuseumsQuartier hatten Sie als Bezirksvorsteher ihre Finger im Spiel, auch die Verkehrsberuhigung in der Lindengasse und die Errichtung des Andreasparks tragen Ihre Handschrift. Es ist beachtlich, was sich alles in den siebeneinhalb Jahren Ihrer Amtszeit von 1991 bis 1998 verändert hat.
Mit voller Hose ist gut stinken! Als ich Bezirksvorsteher wurde, wurde bei der Mariahilfer Straße die U-Bahn gebaut, es gab viele Billig-Shops auf der Mariahilfer Straße, durch die Lindengasse fuhren pro Tag 10.000 Autos … und dann ist die G’schicht’ mit dem MuseumQuartier gekommen. Das war ja eine riesengroße Aufregung.
Ich hatte das Glück – du musst ja Glück auch haben –, dass ich zu einer Zeit Bezirksvorsteher war, als viel zu machen war. Ich wusste nicht, was ich zuerst machen soll! Ich bin in Schulen gegangen – Sie glauben es nicht – da waren Klassenzimmer, die waren fast dunkel. Die waren schon zwanzig Jahre nicht mehr ausgemalt!
Ich bin in die Schule in der Neubaugasse gekommen, zum Direktor Felzmann – auch ein Sozialdemokrat – und habe gesagt, dass ich mir die Schule anschauen möchte, weil ich hier etwas machen möchte. Und er hat zu mir gesagt: „Da sind Sie nicht der Erste. Da waren schon einige da, die das alle gesagt haben, aber g’scheh’n ist bis heute nix.“
Na, die haben wir generalsaniert und die Zollergasse mit der Neubaugasse mit einer riesen Halle verbunden. Als ich als Bezirksvorsteher aufgehört habe, waren alle Schulen renoviert.
Dafür muss man aber auch das Geld finden! Wie haben Sie es eingefädelt?
Die Stadt Wien hat diese Projekte natürlich unterstützt – Hannes Swoboda und Ursula Pasterk, eine Kulturpolitikerin, eine spitzen Frau, mit der ich hervorragendes Einvernehmen hatte. Von beiden hatte ich gewaltige Unterstützung.
Sie dürfen auch eins nicht vergessen: Die U-Bahn ist gebaut worden. Der Andreaspark ist zum Beispiel ein Produkt des U-Bahn-Baus gewesen. Die Stadt Wien hat dort Lagerungen und Baumaterial gehabt und ich hab gesagt: „Wenn sie mit der U-Bahn fertig sind, kommt dort ein Park hin.“ Hannes Swoboda wollte dort ein Wohnhaus hinbauen, aber ich hab drauf bestanden: „Na, da kommt kein Wohnhaus hin, dort kommt ein Park hin.“
Was war dort, bevor das Material gelagert wurde?
Eine Baulücke. Damals gab es so etwas noch, heute findet man das nicht mehr. Und wenn, dann sind schon Leute mit Geld drauf. Betongold nennt man das. Diesen Baugrund hat die Stadt Wien gekauft, um Material für den U-Bahnbau lagern zu können.
Anfang der 1990er gab es acht Bürgerinitiativen im Bezirk, als Sie 1998 in Pension gingen keine mehr. Wie macht man das?
Indem man sich mit allen zusammensetzt. Drei Initiativen gab es wegen Neubaugasse/Lindengasse. Die Neubaugasse, müssen Sie sich vorstellen, da sind der 13A und die Autos durchgefahren. Durch die Lindengasse fuhren täglich 10.000 Autos – die Leute hatten es satt bis oben! Der Vorgänger von mir hat dahingehend nichts gemacht, also hatte ich ein reiches Betätigungsfeld: Verkehr, Schulen, MuseumsQuartier, das Theater der Jugend und einiges mehr.

Und all das in 7 Jahren.
Ja in 7 ½ Jahren. Ich war beschäftigt.
Die Grünen haben oft über mich gelacht … Wir haben die Neubaugasse total umgebaut. Da haben wir aus Vorarlberg eine Maschine bekommen, die den ganzen Asphalt wegschleift. Die Leute haben gesagt: „Ist er jetzt total deppat?“ Aber innerhalb kurzer Zeit war es fertig. Um Mitternacht sind Die Grünen von ihrem Hauptsitz in der Lindengasse heimgegangen, da haben’s mich noch in der Baugrube stehen g’sehen. (lacht) Ja, als Bezirksvorsteher arbeitest du rund um die Uhr.

Was war Ihre größte Niederlage als Bezirksvorsteher?
(nachdenklich) Ich glaube, ich hatte keine.
Vielleicht haben Sie es nur nicht als solche erlebt?
Das kann sein. Dass nicht alles so geht, wie du es dir vorstellst, liegt in der Natur der Sache, aber dass ich beleidigt heimgehe ins Kämmerchen, habe ich nicht erlebt. Ich hatte eigentlich überwiegend Erfolgserlebnisse.
Das Kritische für einen gewählten Bezirksvertreter ist der Zeitpunkt der nächsten Wahl – die Wiederwahl. Wenn du wiedergewählt wirst, steigst du in der Achtung ungleich mehr, als bei der ersten Wahl – „Der hat’s g’schafft.“ Die Wiederwahl ist ein ordentlicher Stress, ein gewaltiger Erfolgsdruck und man muss beweisen: War das eine Eintagsfliege oder nicht?
Als ich aufgehört habe, haben Zeitungen wie Der Standard gefragt: „Warum hören Sie denn auf? Sie sind 61, Sie waren doch erfolgreich.“ Aber die ärgste Kritik bekam ich von meinen Freunden. Das schmeichelt natürlich auch.
Warum haben sie aufgehört?
Weil ich 61 war.
Ich hatte davor ja auch einen Full-Time-Job in der Personalabteilung der ÖBB. Ich war in der Wiener Direktion und später in der Generaldirektion in leitender Funktion.
Dann kam die Zeit als Bezirksvorsteher.
Jetzt müssen Sie sich vorstellen: Du musst zwei Jahre vor der nächsten Wahl aufhören, damit der oder die neue Zeit hat, sich einzuarbeiten. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich 63 bei der nächsten Wahl gewesen und hätte bei einer Wiederwahl nochmal drei Jahre machen müssen, dann wäre ich 66 gewesen. Wissen Sie, was ich von 61 bis 66 gemacht habe? Ich habe die halbe Welt bereist.
Was war besonders schön zu sehen?
Es war vieles schön!
Australien, Neuseeland, China. In China war ich am Lugu-See, dort soll das Matriarchat vorkommen. Dort gibt es noch Minderheiten, bei denen die Frau dem Mann die Schuhe vor die Türe stellt, wenn sie nicht zufrieden ist.
Sie waren hier in der Schule, haben die Entwicklung des Grätzls erlebt, da entsteht sicher eine Verbindung, aus der heraus eine Bereitschaft wächst, sich für den 7. Bezirk zu engagieren?
Klar, auch heute gehe ich noch und sehe manchmal was und denk mir: „Da gehört aber schon was gemacht.“
Kann man das loslassen?
Ja. Nur wenn ich was sehe, das ganz arg ist, dann melde ich mich schon. Besonders mit Thomas Blimlinger [Anm. d. Red.: 2001 – 2017 Bezirksvorsteher des 7. Bezirks, Die Grünen] hatte ich ein ausgezeichnetes Verhältnis und ihn immer wieder mal angerufen.

Gab es einen Moment, in dem Sie dachten, Sie kennen den 7. Bezirk in- und auswendig?
Man kann nie sagen, dass man alles kennt. Das ist nie möglich. Man geht mit offenen Augen durch den Bezirk und immer wenn ich einen Rundgang mache, bekomme ich Fragen, die ich auch nicht beantworten kann. Dann recherchiere ich und schaue nach. So wie die Sache mit dem roten Stern am Volkstheater. Wieso war der da? Wo ist er hin? Im 19. Jahrhundert, 1888, als es gebaut wurde gab’s noch keinen roten Stern am Dach. Diese und andere Geschichten erzähle ich gerne bei den Rundgängen, die ich für die Vienna Greeters mache.
Gibt es einen liebsten Fleck?
Das haben’S mich damals schon gefragt (lacht), aber da bin ich immer ausgewichen. Es gibt den Kulturbereich am Spittelberg und den Wirtschaftsbereich entlang der Mariahilfer Straße und es gibt einen großen Wohnbereich, der bis zum Gürtel reicht und alle haben irgendwie was.
Ist doch logisch: Am Spittelberg sitz ich lieber als am Gürtel.